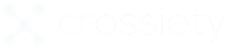Was Entscheidungsträger bei der Digitalisierung der Gemeindekommunikation beachten sollten
Immer mehr Gemeinden stehen vor einer zentralen Entscheidung: Soll eine eigene App entwickelt werden – oder greift man besser auf eine bewährte Plattformlösung zurück? Der Wunsch nach direkter, digitaler Kommunikation mit der Bevölkerung ist nachvollziehbar. Doch bei der Wahl des richtigen Instruments geht es um weit mehr als Technik – es geht um strategische Weitsicht, Ressourceneinsatz und Nachhaltigkeit. Es lohnt sich also, genauer hinzusehen – denn die Praxis offenbart zentrale Herausforderungen, die Entscheidungsträger in ihre Überlegungen einbeziehen sollten.
Hinweis: Am Ende des Beitrages finden Sie acht Fragen, die Sie sich stellen sollten, bevor Sie sich für eine App-Lösung entscheiden.
Hoher Aufwand, begrenzte Wirkung
Der Reiz einer eigenen App liegt auf der Hand: Sie kann visuell an die Gemeinde angepasst werden, liegt technisch in kommunaler Hand und signalisiert Innovationsfreude. Doch der Alltag zeigt: Der Betrieb einer eigenentwickelten App bindet Ressourcen – und oft übersteigt der Aufwand den Nutzen.
Inhalte müssen regelmässig – meist täglich – erstellt werden, meist durch die Verwaltung selbst. Das verlangt weitreichende redaktionelle Fähigkeiten, personelle Ressourcen und langfristiges Engagement. Der technische Betrieb, Sicherheitsupdates und die strategische Weiterentwicklung erfordern IT- und insbesondere App-Kompetenz, die intern oft nicht vorhanden sind. Eine Auslagerung an externe Agenturen führt zwar kurzfristig zu Entlastung, verursacht aber hohe Zusatzkosten – nicht selten mit unklarer Ergebnisverantwortung.
Hinzu kommt: Der Erfolg solcher Eigenlösungen hängt stark von einzelnen Fachpersonen ab. Wenn diese die Verwaltung verlassen, droht ein Know-how-Verlust – sei es das journalistische Handwerk oder die technischen Kompetenzen für den Betrieb und Weiterentwicklung –, der den Betrieb gefährdet. Besonders heikel ist zudem die rechtliche Verantwortung. Beiträge von Dritten, etwa von Vereinen oder dem Gewerbe, müssen einzeln geprüft und manuell freigegeben werden. Das ist sehr zeitaufwändig. Das führt zu Verzögerungen in der Kommunikation und erhöht den Aufwand für die Verwaltung erheblich. Auch die Reichweite solcher Apps bleibt oft begrenzt. Ohne verpflichtende Registrierung mit Wohnortangabe und Verifikation ist unklar, ob tatsächlich die eigene Bevölkerung erreicht wird. Viele Nutzerzahlen wirken auf den ersten Blick eindrucksvoll, sind jedoch Scheinmetriken – sie beinhalten oft externe Nutzer oder automatisierte Zugriffe durch sogenannte Bots. In der Folge lassen sich die gesetzten Kommunikationsziele oft nicht erfüllen – die eigenentwickelte App verfehlt ihren Zweck.
Eigenentwickelte Gemeinde-Apps orientieren sich häufig primär an den Bedürfnissen der Verwaltung – und vernachlässigen dabei die Perspektive der Bevölkerung. Das Ergebnis: Trotz hohem Aufwand bleibt die erhoffte Reichweite oft aus.
Bewährte Plattformlösung als strategische Alternative
Eine Standardlösung wie Crossiety – der Digitale Dorfplatz – bietet hier einen überzeugenden und bewährten Gegenentwurf. Bereits in über 155 Gemeinden im Einsatz, ermöglicht Crossiety nicht nur eine zielgerichtete Kommunikation der Verwaltung in Echtzeit, sondern fördert gleichzeitig die digitale Beteiligung der ganzen Bevölkerung. Bei der Entwicklung der lokalen und vertrauenswürdigen Kommunikationsplattform stand bewusst die Bevölkerung im Fokus – mit dem Ziel, eine aktive Nutzung und maximale Reichweite zu fördern.
Im Gegensatz zu Eigenentwicklungen stehen bei Crossiety nicht nur Information, sondern auch Vernetzung und kontrollierbare Interaktion im Mittelpunkt. Auch lokale Organisationen wie Vereine, Institutionen, Gewerbebetriebe und engagierte Communities können Inhalte veröffentlichen – direkt, unkompliziert und in Echtzeit. Dies führt zu einer signifikant höheren Anzahl relevanter Beiträge bei deutlich geringerem Aufwand für die Verwaltung. Im Durchschnitt benötigt die Verwaltung nur etwa 30 bis 40 Minuten pro Woche. Der Aufwand für Eigenentwicklungen ist in der Regel deutlich höher und liegt oftmals um ein Vielfaches über dem von Standardlösungen.
Ein entscheidender Vorteil: Nur verifizierte Nutzerinnen und Nutzer mit Wohnsitz in der Gemeinde erhalten vollen Zugang zum Digitalen Dorfplatz der entsprechenden Gemeinde. Dadurch ist eine datenschutzkonforme, zielgerichtete und vertrauenswürdige Kommunikation sichergestellt. Gleichzeitig können Vereine und andere lokale Gruppen ihre Mitglieder und Interessierte gezielt benachrichtigen, Veranstaltungen bewerben und interne Gruppen nutzen – alles auf einer zentralen, nutzerfreundlichen Plattform.

Ganzheitliche Unterstützung ohne Zusatzkosten
Ein häufig unterschätzter Aspekt bei der Einführung digitaler Lösungen ist der Betrieb nach der Lancierung. Bei Eigenentwicklungen bleibt die volle Verantwortung bei der Gemeinde – meist zusätzlich zum Tagesgeschäft. Technischer Support, Qualitätskontrolle, Community-Management, Schulung der Mitarbeitenden und Vereine sowie Kommunikationsstrategie müssen intern bewältigt werden. Oft fehlen dafür die nötigen Ressourcen – oder das nötige Know-how.
Bei Crossiety ist das anders: Die Gemeinden werden umfassend begleitet – ohne zusätzliche Kosten. Das Team von Crossiety übernimmt die Prüfung der veröffentlichten Beiträge, organisiert Schulungen, stellt Werbematerialien zur Verfügung und unterstützt bei der Bekanntmachung der Plattform in der Bevölkerung. In regelmässigen Standortgesprächen werden die Nutzung ausgewertet und Optimierungspotenziale gemeinsam identifiziert. Darüber hinaus erhalten Gemeinden laufend inhaltliche Impulse und kommunikative Inspiration – um die digitale Gemeindekommunikation nachhaltig weiterzuentwickeln.
Nachhaltigkeit durch Vernetzung statt Insellösung
Eigenentwicklungen sind naturgemäss Silolösungen ohne Synergiepotential. Der Austausch mit Nachbargemeinden ist kaum möglich – oder nur stark eingeschränkt. Das verhindert die Nutzung wichtiger Netzwerkeffekte, die für die nachhaltige Aktivierung und Entwicklung von aktiven Nutzerinnen und Nutzern von zentraler Bedeutung sind.
Auch in technischer und finanzieller Hinsicht sind Eigenentwicklungen risikobehaftet. Jede neue Funktion, jedes notwendige Update verursacht hohe Zusatzkosten. Gleichzeitig verändern sich die Erwartungen der Nutzerinnen und Nutzer laufend. Was heute modern erscheint, kann in wenigen Jahren überholt sein – und erfordert teure Nachrüstungen oder gar einen kompletten Relaunch.
Viele Gemeinden und Kantone setzen daher längst auf Standardisierung – denn regelmässige Relaunches von eigenentwickelten Gemeindewebseiten waren zu aufwändig und notwendige Updates zu kostspielig. Einheitliche Lösungen im Bereich Webseite und E-Government von Regionen und Kantonen schaffen Synergien, senken den Ressourcenaufwand und erhöhen die Nachhaltigkeit. Gerade in Zeiten des Fachkräftemangels und fehlender Budgets ein logischer Schritt. Auch Crossiety folgt diesem Prinzip. Die Plattform wird kontinuierlich weiterentwickelt – inklusive Hosting, technischer Wartung und strategischer Unterstützung. Alle Gemeinden profitieren automatisch davon – ohne zusätzlichen Aufwand oder versteckte Kosten.
Fazit: Standardlösung mit strategischem Mehrwert
Aktuelle Beispiele zeigen, wie viel Engagement hinter einer eigenen App stecken kann – aber auch, wie hoch der versteckte Aufwand ist. Wer die Erfahrungen anderer Gemeinden einbezieht, erkennt: Eine bewährte Plattformlösung wie Crossiety bietet nicht nur mehr Funktionalität und geringeren Aufwand, sondern auch langfristige Sicherheit und deutlich mehr Wirkung.
Entscheidungsträger, die heute eine Gemeinde-App planen, sollten sich deshalb eine einfache, aber zentrale Frage stellen: Warum das Rad neu erfinden – wenn eine erprobte, zukunftssichere Lösung längst bereitsteht?
Fragen, die sich Gemeinden stellen sollten, bevor sie sich für eine App-Lösung entscheiden:
- Wer betreut die App im Alltag?
Haben wir intern genügend Ressourcen und Know-how für Redaktion, Support und technische Weiterentwicklung? - Wie stellen wir sicher, dass unsere Informationen wirklich bei den Einwohnerinnen und Einwohnern unserer Gemeinden ankommen?
Können wir gezielt und datenschutzkonform kommunizieren – oder bleiben wir in der unkontrollierbaren Breitenstreuung? - Wer darf Inhalte veröffentlichen?
Wollen wir eine Einwegkommunikation oder ein System, das auch Vereinen, Schulen, Gewerbe und weiteren Akteuren offensteht? - Wie nachhaltig ist unsere Lösung?
Können wir die App technisch und finanziell auch in fünf Jahren noch betreiben? Wie abhängig sind wir von Fachkompetenzen einzelner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter? - Wie viel kostet eine Weiterentwicklung?
Was passiert, wenn wir neue Funktionen brauchen – und wie schnell und kosteneffizient können wir sie umsetzen? Wer priorisiert und spezifiziert gewünschte Funktionen? Wer innerhalb der Verwaltung kann die Angebote und Kostenschätzungen externer Tech-Agenturen realistisch einschätzen und wirksam kontrollieren – insbesondere bei der Weiterentwicklung der App? - Wie aktivieren wir unsere Bevölkerung?
Haben wir eine klare Kommunikationsstrategie, um die App bekannt zu machen und aktiv zu halten? - Welche Unterstützung erhalten wir vom Anbieter?
Werden wir geschult, beraten und begleitet – oder stehen wir nach der Einführung alleine da? Falls ja, mit welchen Zusatzkosten sind diese Leistungen verbunden? - Wie lernen wir aus der Nutzung?
Gibt es regelmässige Auswertungen, Nutzerfeedback oder Benchmarks, um die Wirkung zu messen und die Plattform weiterzuentwickeln?
Gerne beraten wir Sie in einem unverbindlichen Gespräch. Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme: gemeinden@crossiety.ch